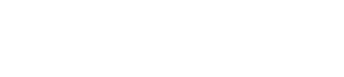DSAG Technologietage 2025: „Strategy Royale: Call, Raise or Fold“ – Keynote von Sebastian Westphal
Analyse und Bewertung der SAP-Strategie aus Anwenderperspektive
Zusammenfassung der Keynote von Sebastian Westphal, Vorstand der Deutschen SAP-Anwendergruppe (DSAG)
Executive Summary
Die Technologietage der Deutschen SAP-Anwendergruppe (DSAG) standen in diesem Jahr unter dem Motto „Strategy Royale: Call, Raise or Fold“ – eine treffende Analogie zu den strategischen Entscheidungen, vor denen SAP-Anwenderunternehmen angesichts der neuen SAP-Zielstrategie stehen. DSAG-Vorstand Sebastian Westphal präsentierte in seiner Keynote eine differenzierte Analyse der aktuellen Marktlage und formulierte konkrete Erwartungen an die künftige Ausrichtung des Walldorfer Softwarekonzerns. Diese Zusammenfassung bietet eine Aufarbeitung der zentralen Themen und Positionen sowie eine Bewertung der strategischen Implikationen für Unternehmen.
- Die Positionierung der DSAG: Erfolgreiche Initiativen und strategische Weichenstellungen
Die DSAG hat sich in den vergangenen Monaten als maßgebliche Interessenvertretung der SAP-Anwenderunternehmen etabliert und durch verschiedene Initiativen wichtige inhaltliche Akzente gesetzt.
1.1 Positionspapiere und Deep-Dive-Sessions
Die DSAG hat mehrere fundierte Positionspapiere zu zukunftsweisenden Technologiethemen veröffentlicht, darunter:
- Künstliche Intelligenz und ihre Anwendungspotenziale
- NIST 2-Richtlinien und deren Implikationen für die IT-Sicherheit
- Green IT als Zukunftsfeld nachhaltiger Unternehmens-IT
- Eine umfassende Deep-Dive-Session zur S/4HANA Public Cloud V9
Die hohen Download- und Zugriffszahlen – knapp 1.200 Zugriffe auf die deutsche und eine Reichweite von 15.000 Kontakten für die englische Pressemitteilung zu SAPs Ankündigungen der Business Suite und Business Data Cloud – unterstreichen die Relevanz dieser Publikationen für die Community.
Link zum Download: https://dsag.de/leistungen/einfluss/dsag-positionspapiere/
1.2 Formate zu Künstlicher Intelligenz
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Thema Künstliche Intelligenz. In mehreren Workshops mit insgesamt über 4.000 teilnehmenden Mitgliedern wurden konkrete Anwendungsfälle, Referenzarchitekturen und spezifische Use Cases erarbeitet, unter anderem zu:
- Co-Piloten und deren Einsatzmöglichkeiten
- Code-Generierung mithilfe von KI
- Dokumentenverarbeitung durch KI-gestützte Systeme
Die DSAG plant, dieses erfolgreiche Format nun auf das Thema SAP Business Technology Platform zu übertragen. Nach einer initialen Kick-off-Session ist bereits ein Deep Dive zu SAP Joule geplant, der von technischen Grundlagen bis zum praktischen Einsatz für Consultants und Developer reichen wird.
1.3 Souveräne Cloud-Initiativen
In Zusammenarbeit mit dem Partner Stack-IT treibt die DSAG das Thema Souveräne Cloud voran. Zentrale Fragestellungen betreffen:
- Den konkreten Zeitpunkt und Umfang der Einführung einer datensouveränen Cloud-Lösung
- Die Roadmap für die Verwaltung von Stack-IT
- Sicherheitslösungen und das Hacker-Abwehrzentrum von Stack-IT
1.4 Linux-Fokus und Tech Exchange
Die Element-Reihe zu Linux verzeichnete mit 700 Teilnehmern ebenfalls einen beachtlichen Erfolg. Neben Grundlagen, Use Cases und praktischen Tipps wird es künftig:
- Eine exklusive Session zur Produktstrategie mit Linux-Gründer André Christ geben
- Ein entsprechendes Training in die DSAG Academy aufgenommen
- Die Linux Customer Days erstmals in Kooperation mit der DSAG durchgeführt
Der Tech Exchange als Plattform für Entwickler und DevOps-Experten wird mit knapp 600 Teilnehmern fortgesetzt und erstmals in englischer Sprache abgehalten, was die internationale Ausrichtung der DSAG unterstreicht.
1.5 Strategische Neuausrichtung beim Security-Dashboard
Eine bemerkenswerte strategische Entscheidung betrifft das Security-Dashboard. Die DSAG-Experten werden dieses Ziel nicht weiter verfolgen, da:
- SAP sich zunehmend auf Cloud-Lösungen konzentriert, während DSAG-Mitglieder weiterhin On-Premise-Systeme benötigen
- Die Zusammenarbeit keine zügigen und tiefgreifenden Fortschritte erbracht hat
- Viele Unternehmen inzwischen auf eigene Entwicklungen setzen
- Die aktuelle Security-Umfrage gezeigt hat, dass die Community andere Prioritäten setzt: Patch-Management, System-Hardening und sichere Entwicklungen
- Strategische Optionen für SAP-Anwenderunternehmen
Sebastian Westphal skizzierte drei grundlegende strategische Optionen für SAP-Anwenderunternehmen, die er metaphorisch mit Poker-Strategien verglich:
2.1 Call – Vorsichtiges Mitgehen
Diese defensive Strategie setzt auf:
- Optimierung bestehender Systemarchitekturen
- Abwarten auf ein besser kalkulierbares Marktumfeld
- Risikominimierung bei gleichzeitiger Weiterentwicklung
Diese auf den ersten Blick sichere Variante birgt langfristig durchaus strategische Risiken, insbesondere hinsichtlich technologischer Wettbewerbsfähigkeit.
2.2 Raise – Proaktive Investition mit RISE
Der offensive Ansatz fokussiert auf:
- Aktives Vorangehen und signifikante Investitionen in neue Technologien
- Aufbau neuer Plattformen und Automatisierung von Prozessen
- Aktive Gestaltung der digitalen Zukunft
Diese Strategie erfordert höhere Investitionen und die bewusste Übernahme von Risiken, verspricht jedoch potenziell größere Wettbewerbsvorteile.
2.3 Fold – Punktuelles Aussteigen
Die selektive Rückzugsstrategie konzentriert sich auf:
- Bewusstes Aussteigen aus bestimmten SAP-Technologiebereichen
- Vermeidung unsicherer Strategien und hoher Risiken
- Konzentration auf alternative Lösungsansätze
Westphal betonte, dass der Erfolg jeder dieser Strategien maßgeblich von den Rahmenbedingungen abhängt, die SAP für alle Marktteilnehmer schafft.
- Die neue SAP-Zielstrategie und ihre Herausforderungen
SAP hat beim „Business Unleashed Event“ eine neue Strategie präsentiert, die darauf abzielt, Unternehmen durchgängige Prozessketten sowie daten- und KI-gestützte Entscheidungen zu ermöglichen. Westphal sieht darin Parallelen zum früheren Konzept der „Integrated Suite“ aus der On-Premise-Ära, stellt jedoch fest, dass das SAP-Portfolio in den letzten Jahren durch Übernahmen, technologische Änderungen und den Cloud-Fokus zunehmend fragmentiert wurde.
3.1 Aktuelle Herausforderungen
Die gegenwärtige Situation ist durch mehrere Herausforderungen gekennzeichnet:
- Funktionelle und funktionale Lücken im SAP-Portfolio
- Notwendigkeit weiterer Integrationsschritte
- Fehlen einer konsistenten Datenarchitektur
- Hoher individueller Aufwand für Unternehmen bei Integration und Harmonisierung
3.2 Anforderungen an eine erfolgreiche Business Suite
Für eine erfolgreiche Umsetzung der neuen SAP-Strategie formulierte Westphal konkrete Anforderungen:
3.2.1 Architektur und Funktionalität
- Modularer Aufbau für flexible Anpassung an Unternehmensanforderungen
- Konsistente Architektur in Datenmodellen, Identity, Security und Betriebsservices
- Harmonisierung der Produktlandschaft und Etablierung einheitlicher Standards
- Nahtlose Integration in bestehende Unternehmensarchitekturen ohne signifikanten Mehraufwand
3.2.2 Kommerzielles Modell und Partnerstrategie
- Transparente Kosten- und Vertragsgestaltung
- Erkennbarer kommerzieller Vorteil beim Bezug des Gesamtportfolios aus einer Hand
- Langfristige Unterstützung für Partner-Add-ons im Rahmen der Clean-Core-Strategie
- Stabile Betriebs- und Zertifizierungsbedingungen, die mit der S/4-Wartungszusage bis 2040 korrespondieren
- Kritische Bewertung des RISE-Portfolios
Das aktuelle RISE-Angebot, das Unternehmen auf eine „Journey“ in Richtung Private oder Public Cloud führen soll, weist nach Westphals Analyse mehrere Schwachpunkte auf:
4.1 Aktuelle Defizite
- Fokus primär auf Vierschichtbetriebsmodell, nicht auf Gesamtarchitektur
- Mangel an einheitlicher Integration verschiedener SAP-Lösungen
- Fehlen eines harmonisierten Betriebs über verschiedene Komponenten hinweg
- Uneinheitliches kommerzielles Modell für das gesamte Anwendungsportfolio
4.2 Konkrete Anforderungen an RISE/GROW
Für eine höhere Attraktivität des RISE-Angebots formulierte Westphal folgende Anforderungen:
4.2.1 Integration und Betrieb
- Bessere Integrierbarkeit in bestehende hybride Unternehmensarchitekturen
- Bereitstellung von Innovationen losgelöst von kommerziellen Konstrukten
- Einheitliches, integriertes Preismodell über alle SAP-Produkte hinweg
- Integration in bestehende Betriebs- und Serviceprozesse der Unternehmen
4.2.2 Sicherheit und Compliance
- Transparenz über alle sicherheitsrelevanten Services mit klarem Scope
- Vollständige Einhaltung der NIS2-Richtlinien
- Verbesserungen bei Log-Auditing, Entitäts-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung für Operatoren und automatisiertem Deployment von Zertifikaten
4.2.3 Service und Support
- Harmonisiertes Leistungsportfolio aus einer Hand
- Einheitliche Verantwortung für Migration, Cloud-Services und Betrieb
- EU-Access für kritische Systeme und Branchen
- Deutschsprachiger 24/7-Support für kritische Prozesse und hochverfügbare Systeme
- Die Business Technology Platform als technologisches Fundament
Die Business Technology Platform (BTP) bleibt nach Westphals Einschätzung das technologische Fundament der SAP-Strategie, bedarf jedoch deutlicher Verbesserungen:
5.1 Aktuelle Herausforderungen
- Organisch gewachsene, heterogene Service-Landschaft
- Fehlen einheitlicher Standards für die Integration
- Komplexe Governance- und Operations-Strukturen
5.2 Erforderliche Verbesserungen
Für eine höhere Attraktivität und bessere Nutzbarkeit der BTP formulierte Westphal folgende Anforderungen:
5.2.1 Governance und APIs
- Übergreifende Steuerung und Überwachung der BTP
- Konsistente Grundsätze für APIs aller BTP-Services
- Einheitliche Governance für Monitoring, Logging, Security und Transportwesen
5.2.2 Benutzer- und Berechtigungsmanagement
- Umsetzung der im CIO-Guide definierten Strategien für einheitliches Identity-Management
- Vermeidung inkonsistenter Verwaltungsstrukturen
- Zentralisierte Benutzer- und Rechteverwaltung
5.2.3 Preisgestaltung und Zertifikatsmanagement
- Konsistente und transparente Preisstruktur
- Zentraler Einstiegspunkt für alle SAP-Services
- Ersetzung der manuellen Zertifikatspflege durch ein zentrales Zertifikats-Lebenszyklus-Management
- Die Business Data Cloud als strategische Innovation
Die Business Data Cloud (BDC) stellt nach Westphals Analyse den größten Strategiewechsel seit S/4HANA dar und zielt darauf ab, fragmentierte Datenstrukturen zu harmonisieren und die Verantwortung für Integration und Datenqualität stärker zu zentralisieren.
6.1 Potenzial und Herausforderungen
Das Konzept einer einheitlichen Datenarchitektur über alle SAP-Produkte hinweg bezeichnet Westphal als potenziellen „Game Changer“, identifiziert jedoch mehrere Herausforderungen:
- Komplexe Transformation bestehender Landschaften in eine zukunftsfähige Cloud-Architektur
- Offene kommerzielle Fragen zu vertraglichen und betrieblichen Konstrukten
- Schwer kalkulierbares Lizenzmodell mit Capacity Units
- Begrenzte maximale Datengröße von 12 Terabyte als potenzielle Einschränkung für Großunternehmen
- Erhebliche Vorinvestitionen der Unternehmen in bestehende datenhaltende Architekturen
6.2 Anforderungen an die Business Data Cloud
Für eine erfolgreiche Implementierung der BDC formulierte Westphal folgende Anforderungen:
6.2.1 Architektur und Standards
- Schnelle Definition verbindlicher Standards und einer passenden Architekturstrategie
- Integration von SAP-Daten in bestehende Architekturen ohne hohe kommerzielle und technische Restriktionen
- Unbeschränkte Produktnutzung unabhängig von kommerziellen Konstrukten wie RISE oder Cloud
6.2.2 Technische Anforderungen
- Verlässliche Bereitstellung der Datenprodukte für alle SAP-HANA-Betriebsmodelle
- Umsetzung einer Data-as-Product-Philosophie
- Klare Migrationsstrategie für bestehende SAP-Architekturen mit entsprechenden Best-Practice-Guides und Migrationsservices
6.2.3 Kommerzielles Modell und Innovation
- Flexible und transparente Lizenz- und Rabattmodelle mit verständlichen Mengengerüsten
- Anreize für Investitionen durch Mengenvorteile
- Insights-Apps mit konkretem Business-Nutzen und geringen technischen Hürden
- Uneingeschränkte Nutzbarkeit von Databricks für AI und Data-Warehousing-Funktionen mit Integration bestehender Verträge
- Fazit und strategische Bewertung
Sebastian Westphal betonte in seiner Keynote, dass der Erfolg der neuen SAP-Strategie maßgeblich davon abhängen wird, ob es dem Softwarekonzern gelingt, sein Portfolio zu harmonisieren und die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen der Anwenderunternehmen auszurichten.
Die von ihm skizzierten Anforderungen stellen einen klaren Handlungsauftrag dar:
- Harmonisierung und Integration: SAP muss sein zunehmend fragmentiertes Portfolio vereinheitlichen und nahtlos integrierbar machen.
- Technologische Konsistenz: Einheitliche Standards für Datenmodelle, APIs, Sicherheit und Betrieb sind unerlässlich.
- Transparente Kommerzialisierung: Verständliche und vorhersehbare Preis- und Lizenzmodelle sind für langfristige Investitionsentscheidungen notwendig.
- Souveränitätswahrung: Angesichts der geopolitischen Lage müssen Datenhoheit und Compliance-Anforderungen besondere Berücksichtigung finden.
- Kooperative Partnerstrategie: Die Einbindung des Partner-Ökosystems und die langfristige Unterstützung von Add-ons sind entscheidend für den Gesamterfolg.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, könnten Business Suite, Business Technology Platform und Business Data Cloud für die Anwenderunternehmen zu einem „Royal Flush“ werden – andernfalls drohen risikobehaftete Investitionen mit ungewissem Ausgang.
Die DSAG wird diesen Transformationsprozess weiterhin kritisch-konstruktiv begleiten und die Interessen der Anwenderunternehmen vertreten. Die kommenden Monate werden zeigen, inwieweit SAP bereit ist, auf die formulierten Anforderungen einzugehen und seine Strategie entsprechend anzupassen.
© 2025 Synaworks Community | Blogartikel zu den DSAG Technologietagen 2025